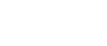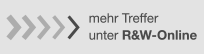Unternehmensverantwortung und Menschenrechte – zur Bedeutung der sog. “Ruggie-Rules”

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht das Thema Menschenrechte in die Medien Eingang findet. Meist geht es dabei um die “hohe Politik”. Immer häufiger müssen sich aber auch international tätige Unternehmen mit Fragen des Menschenrechtsschutzes auseinandersetzen.
Für Unternehmen, denen eine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wird, kann dies gravierende Imageprobleme zur Folge haben. Darüber hinaus kann sich die Haftungsfrage stellen: In den U SA laufen derzeit mehrere – auf das A lien Tort Statute, ein Gesetz aus dem Jahre 1776, gestützte – Verfahren gegen Unternehmen, denen eine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen außerhalb der USA vorgeworfen wird (dazu Reynolds/Zimmer, RIW 2112, 139). Auch in anderen Ländern sind gegen dort ansässige Unternehmen vergleichbare Verfahren denkbar oder es gibt sie bereits (etwa in den Niederlanden; so Saage-Maaß, Arbeitsbedingungen in der globalen Zulieferungskette, FES “Globale Politik”, 2011, 7). Wie können sich Unternehmen hierauf einstellen?
Vor etwa einem Jahr hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (Human Rights Council, UNHCR) ein umfangreiches Regelwerk zum Schutz der Menschenrechte beschlossen (www.bu siness-humanrights.org/SpecialRepPor tal/home). Diese “Guiding Principles on Business and Human Rights” sind das Ergebnis eines mehrjährigen unter dem Dach der Vereinten Nationen und der Beteiligung internationaler Experten durchgeführten Konsultations- und Beratung sprozesses unter Leitung von Professor Ruggie (daher “Ruggie-Rules”), den der Generalsekretär der Vereinten Nationen mit dieser Aufgabe betraut hatte.
Im ersten Teil richten sich die “Ruggie-Rules” an die Staaten als die in ihren Gebieten und im Rahmen ihrer Jurisdiktion für die Achtung der Menschenrechte primär verantwortlichen Völkerrechtssubjekte. Adressaten des zweiten Teils des Regelwerkes sind dagegen Wirtschaftsunternehmen, denen es – so heißt es im Vorspann – obliegt, geltende Gesetze und Menschenrechte zu respektieren (“required to comply”).
Es ginge zu weit, vorliegend auf alle Einzelheiten der “Ruggie-Rules” zur Unternehmensverantwortung einzugehen. Die folgenden Ausführungen sollen sich daher auf wesentliche Grundlinien der “Ruggie-Rules” hierzu beschränken.
Festzustellen ist zunächst, dass die “Ruggie-Rules” die Verantwortung der Unternehmen nicht auf deren “eigenes” Verhalten (Rule 13 (a): “causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities”) begrenzt sehen. Die Verantwortung von Unternehmen schließt – so Rule 13 (b) – vielmehr auch die Vermeidung der Beeinträchtigung von Menschenrechten durch Dritte ein, mit denen die Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhalten, wenn die fraglichen Menschenrechtsverletzungen zu diesen Geschäftsbeziehungen in “direkter” Verbindung (“directly linked”) stehen. Diese Dritten können Geschäftspartner, Einheiten in der Wertschöpfungskette bzw. staatliche oder nicht-staatliche Organisationen sein (Rule 13, commentary).
Dreh- und Angelpunkt der Unternehmensverantwortung ist das Gebot der Wahrung der erforderlichen Sorgfalt zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen (Rule 17: “Human rights due diligence”). Im Kern geht es hierbei darum, dass die Unternehmen schon im Vorfeld der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen vorbeugen. Dazu sollen sie eine Risikoabschätzung durchführen (Rule 17 (a)) und auf deren Ergebnisse entsprechend reagieren (Rule 18). Zu den gebotenen Vorsorgemaßnahmen gehören Verhaltensrichtlinien innerhalb der Unternehmen (Rule 16: “Policy commitment”), die interne Aufgabenzuweisung (Rule 16 (e)), das Erstellen und Einholen interner und externer Expertisen (Rule 18 (a)), das Einbeziehen der Ergebnisse dieser Erkenntnisse in die Entscheidungsprozesse (Rule 19), Ergebniskontrollen (Rule 20) und die Dokumentation dieses Verfahrens (Rule 21).
Die “Ruggie-Rules” sind weder Gegenstand international bindender Konventionen noch verbindlicher nationaler Gesetze. Sie verweisen hinsichtlich möglicher haftungsrechtlicher Konsequenzen bei Verstößen gegen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auf die nationalen Rechtsordnungen (Rule 12, commentary, Abs. 2; Rule 17, commentary, letzter Absatz; Rule 25, commentary, Abs. 2 und Abs. 4) und fordern zugleich von den Staaten verbindliche nationale Regeln zum Ausgleich von Beeinträchtigungen durch Menschenrechtsverletzungen (Rules 25 ff.). Dabei gehen sie von einem weiten Menschenrechtsbegriff entsprechend den zentralen Menschenrechtskonventionen aus (Rule 13).
Die Frage, ob bei der Prüfung etwaiger Haftungsansprüche nach nationalem Recht die “Ruggie-Rules” unter dem Gesichtspunkt einzuhaltender Sorgfaltspflichten zu berücksichtigen sind und wie in diesem Zusammenhang der Kreis deliktsrechtlich geschützter Menschenrechte sowie relevanter Schutzgesetze zu bestimmen ist, muss hier offenbleiben. Deutsche Entscheidungen dazu gibt es noch nicht. In der Schweiz wird unter Berufung auf ein Urteil des Schweizer Bundesgerichts (BGE 136 IV 97 [Rappaz] 112) diskutiert, inwieweit die “Ruggie-Rules” bei der Konkretisierung rechtlicher Sorgfaltspflichten relevant sind (www.humanrights.ch/de/themendossiers, update 20. 5. 2012). So viel lässt sich prognostizieren: Unternehmen, die sich an die “Ruggie-Rules” halten, dürften auf der “sicheren Seite” sein.
Dr. Will Frank, Dipl.-Ök., Ministerialdirigent a. D., Mannheim