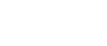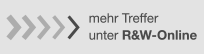Die Mindeststeuer – stark gestartet schwach geendet!

Der Autor
lehrt an der FHDW Paderborn Steuerrecht,
Rechnungswesen, Controlling und Com
pliance und ist Ressortleiter Steuerrecht
des Betriebs-Berater und Chefredakteur
Der Steuerberater.
Mindeststeuer wirkungslose Bürokratie mit Standortnachteil
Die Wurzeln der Mindestbesteuerung reichen zurück bis in die frühen 2010er Jahre, als Organisationen wie die OECD und die G20 begannen, sich intensiv mit dem Problem der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (“Base Erosion and Profit Shifting”, BEPS) auseinanderzusetzen. Im Jahr 2013 startete die OECD das BEPS-Projekt, das darauf abzielte, Lücken und Ungleichgewichte in internationalen Steuersystemen zu adressieren. Eines der wichtigsten Ergebnisse war die Entwicklung eines Zwei-Säulen-Modells:
-
Säule 1: Besteuerung digitaler Wirtschaft und Umverteilung von Besteuerungsrechten.
-
Säule 2: Einführung einer globalen Mindeststeuer für große, multinational agierende Unternehmen.
Im Jahr 2021 verkündeten fast 140 Staaten und Jurisdiktionen ihre Bereitschaft, die Mindestbesteuerung mit einem effektiven Steuersatz von zumindest 15 % einzuführen. Dies markierte einen historischen Durchbruch in der internationalen Zusammenarbeit. Überwiegend große, international tätige Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Mio. Euro sollten von der Mindestbesteuerung, auch als “Global Anti-Base Erosion”-Regelung (GloBE) bekannt, betroffen sein. Der weltweite Umsatz dieser Unternehmen sollte wenigstens mit 15 % besteuert werden. Bleibt die tatsächliche Besteuerung in einem Land unter diesem Satz, können andere Staaten eine Nachbesteuerung vornehmen. So sollten Verlagerung von Gewinnen in Niedrigsteuerländer verhindert werden. Der Nachbesteuerungsmechanismus führt dazu, dass Muttergesellschaften im Heimatland Differenzbeträge zahlen, wenn im Ausland niedrigere Steuern anfallen. Flankiert werden diese Maßnahmen mit einer umfangreichen Berichterstattung, um Transparenz zu gewährleisten.
Von Anfang an haben die Befürworter der Mindeststeuer beim Jubel über den internationalen Konsens übersehen, dass es erhebliche Vorbehalte bei der praktischen Umsetzung geben werde. Es war zu beobachten, dass in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union sowie in Schwellen- und Entwicklungsländern unterschiedliche Interessen und Interpretationen festzustellen waren. In der EU äußerten steuerlich attraktive Länder wie Irland und Ungarn Bedenken, dass diese um ihre Wettbewerbsfähigkeit bangten. Innenpolitische Differenzen verzögerten das Projekt in den USA. Entwicklungsländer gaben zu Bedenken, dass sie bei der Nachbesteuerung größtenteils leer ausgehen werden.
Der Stand heute: Lediglich 50 der rund 140 Staaten haben die Mindeststeuer umgesetzt, darunter die Mitgliedstaaten der EU. Interessanter ist aber, wer sie nicht umgesetzt hat, nämlich zwei große Wirtschaftsräume, China und Indien. Auch die BRIC-Staaten setzten die Mindeststeuer nicht um.
Und nun auch noch das: Die Mindeststeuer wird für Konzerne aus den USA nicht gelten! US-Präsident Trump machte von Anfang an klar, was er von der Steuer hält, nämlich nichts. Schlimmer noch, er plante Vergeltungsmaßnahmen in Form von drastischen Strafsteuern für Investoren aus Staaten mit “unfairer” Steuerpolitik. Zu den unfairen Praktiken gehöre aus Sicht der USA auch die Mindeststeuer, die dazu führen könne, dass US-amerikanische Unternehmen zu Zusatzsteuern herangezogen worden wären. Aus Sicht der USA war dies eine Bedrohung der amerikanischen Wirtschaft. Mit “Section 889” aus der “One Big Beautiful Bill” planten die USA auf Dividendenzahlungen von Anlegern aus sog. “unfairen” Staaten zusätzliche Steuern zu erheben und die Gewinne in den USA einer höheren Steuerlast zu unterwerfen. Betroffen worden wären europäische Unternehmen und europäische Anleger. Auf dem G7-Gipfel 2025 in Kananaskis (Kanada) gewannen die US-Amerikaner nun die Auseinandersetzung auf ganzer Linie. Die G7-Staaten erklärten sich bereit, US-Konzerne von der Mindeststeuer auszunehmen. So konnte ein Streit auf offener Bühne verhindert werden. Der Kompromiss führt dazu, dass die Gewinne von US-amerikanischen Unternehmen nur in den USA versteuert werden, ganz gleich wo sie auf der Welt erzielt werden. Inlands- und Auslandsgewinne zu einem Steuersatz. Die OECD muss nun das Regelwerk anpassen. Im Gegenzug verzichtet die USA auf “Section 889”. Der deutsche Finanzminister freut sich, dass dieser Kompromiss es möglich mache, “den Kampf gegen Steueroasen, Steuerflucht und Steuerdumping jetzt weiter vorantreiben können”, so Lars Klingbeil (SPD). “Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern erreicht, dass die USA bei der globalen Mindestbesteuerung nicht im Weg stehe”, so Klingbeil. OECD- und US-Mindeststeuern könnten nebeneinander bestehen.
Dabei wird übersehen, dass sich die Mindeststeuer für europäische Unternehmen so zu einem extremen Standortnachteil entwickeln wird. Die größten Wirtschaftsräume der Welt machen nicht mit! Den europäischen Unternehmen bleiben die horrenden Implementierungskosten, die das ZEW mit ca. 320 Mio. Euro beziffert. Für die jährlichen Folgekosten geht das ZEW für deutsche Unternehmen von ca. 100 Mio. Euro aus. Ob diesen Kosten wesentliche steuerliche Mehreinahmen aus der Mindeststeuer für Deutschland gegenüberstehen werden? Zweifel gab es von Anfang an. Diese Zweifel haben nun wohl immerhin einige Landesfinanzminister erreicht, denen schwant, dass außer dem zusätzlichen administrativen Aufwand für die Unternehmen, als kein positiver Effekt zu verzeichnen sein wird. Sie ahnen, dass der administrative Aufwand auch an der Finanzverwaltung nicht vorbeigeht. Der hessische Finanzminister Professor Alexander Lorz äußerte kürzlich: “Die globale Mindeststeuer muss ausgesetzt werden!” Recht hat er.
Prof. Dr. Michael Stahlschmidt, M.R.F., LL.M., MBA, LL.M., Frankfurt a. M.