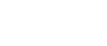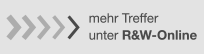Kommt die Green-Claims-Richtlinie oder nicht?
Die EU-Kommission sollte sich auf ihre eigenen Guidelines zur „Better Regulation“ besinnen

RA Sebastian Wasner

RAin Dr. Jeannette Viniol,
LL.M. (Warwick)
Die „Richtlinie über die Begründung von Umweltaussagen und die diesbezügliche Kommunikation“ („Green Claims“-Richtlinie, COM (2023) 166 final, „GCR“) sollte Ende Juni 2025 die abschließenden Trilog-Verhandlungen durchlaufen. Diese wurden jedoch kurzfristig ausgesetzt, nachdem die Kommission (nach entsprechender Aufforderung der EVP) am 20. 6. 2025 bekanntgegeben hatte, dass sie erwägt, ihren Vorschlag zurückzuziehen. Zudem erklärte auch Italien, die Unterstützung für das Vorhaben zurückzuziehen, wodurch die erforderliche Mehrheit im Rat gefährdet ist. Kurzzeitig schien der Richtlinien-Vorschlag vom Tisch zu sein. Nur wenige Tage später relativierte die Kommission ihre Ankündigung jedoch dahingehend, dass sie den Vorschlag nur zurückziehen werde, wenn Kleinstunternehmen von der Regelung nicht ausgenommen werden. Dänemark erklärte nach Übernahme der Ratspräsidentschaft am 1. 7. 2025, die Richtlinie weiter verhandeln zu wollen. Insoweit ist sie allenfalls vorläufig blockiert, ihr weiteres Schicksal offen.
Die Kritik an dem Entwurf ist berechtigt; sie kann auch nicht durch Ausnahmen für Kleinstunternehmen entkräftet werden: Nach der GCR müssen umweltbezogene Werbeaussagen künftig wissenschaftlich belegt sein. Herzstück der Richtlinie ist die Verpflichtung, den jeweiligen Claim, seine Begründung sowie die ebenfalls vorgeschriebene Kommunikation der Begründung vor der Veröffentlichung durch eine externe Zertifizierungsstelle prüfen zu lassen.
Damit würden an Umweltaussagen künftig strengere Anforderungen gestellt werden als beispielsweise an Werbeaussagen mit Gesundheitsbezug. Neben dem mit der Durchführung der Zertifizierung einhergehenden finanziellen und administrativen Aufwand stellt sich bereits die Frage nach deren Umsetzbarkeit – bislang ist unklar, welche Stellen die Vorabprüfung vornehmen sollen. Klar ist hingegen, dass Werbung mit Umweltbezug eines ihrer wichtigsten Elemente zu verlieren droht: die Möglichkeit, schnell und flexibel auf neue Produkte und aktuelle Trends zu reagieren. Doch damit nicht genug: Der für die Werbung mit „Green Claims“ erforderliche Aufwand gefährdet sogar das Ziel des sog. „Green Deal“, den Wettbewerb um die beste Umweltleistung zu fördern. „Grüne Werbung“ könnte zum Auslaufmodell werden – und damit auch das Streben nach einer möglichst nachhaltigen Produktgestaltung.
Dabei liegt der Umgang mit der GCR eigentlich nahe: Aktuell befindet sich mit der sog. „EmpCo-Richtlinie“ (COM (2022) 143 final) eine Regelung in der Umsetzung, die viele der von der GCR avisierten Probleme bereits adressiert. So sollen allgemeine Umweltaussagen wie „umweltfreundlich“ nur noch zulässig sein, wenn sie auf einer anerkannten, hervorragenden Umweltleistung beruhen, die etwa dann vorliegen soll, wenn die Voraussetzungen einschlägiger Umweltkennzeichen wie dem EU-Umweltzeichen erfüllt sind. Die Werbung mit der Klimaneutralität eines Produktes, die faktisch nur auf Kompensationsleistungen beruht, wird untersagt. Strengere Regeln zur Werbung mit Nachhaltigkeitssiegeln, zur Überdehnung von Umweltaussagen zu Teilaspekten auf das gesamte Produkt und zur Werbung mit der Einhaltung ohnehin bestehender Umweltvorgaben komplettieren das neue Regelwerk, das ab September 2026 in den Mitgliedsstaaten gilt. Einen entsprechenden Referentenentwurf zur Änderung des UWG hat das Justizministerium am 7. 7. 2025 vorgelegt.
Es besteht also ein dringender Anlass, die Umsetzung und Wirkung der EmpCo-Richtlinie abzuwarten. Nur dann kann ermittelt werden, ob noch ergänzender Regelungsbedarf besteht und ob dieser die wirtschaftlichen Belastungen sowie die Einschränkung der Werbefreiheit durch das Zertifizierungsverfahren rechtfertigen kann. Nur so würde die Kommission ihren eigenen Vorgaben zur „besseren Rechtssetzung“ („Better Regulation Guidelines“) gerecht, die für jede Gesetzesinitiative mit erheblichen Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft ein sog. „Impact Assessment“, also eine Folgenabschätzung, vorsehen. Diese ist für die GCR bislang nicht erfolgt und kann aktuell auch noch nicht sinnvoll erfolgen, da vor Umsetzung der EmpCo-Richtlinie keine evaluierbare Ausgangslage vorliegt. Abgesehen davon darf schon heute bezweifelt werden, ob die GCR ein derartiges „Impact Assessment“ überstehen würde. Den Anforderungen an eine „bessere Rechtssetzung“, die für die Bürger und Unternehmen leicht zu befolgen und so wenig belastend wie möglich sein soll („easy to comply with and with the least burden possible“), entspricht sie kaum.
RA Sebastian Wasner* und RAin Dr. Jeannette Viniol, LL.M. (Warwick)**
| * | Sebastian Wasner ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in der Kanzlei JBB in Berlin mit Beratungsschwerpunkten im Wettbewerbs- und Kosmetikrecht. |
| ** | Dr. Jeannette Viniol, LL.M. (Warwick) ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz und Partnerin der Kanzlei JBB in Berlin sowie Lehrbeauftragte an der TU Dresden. Sie berät schwerpunktmäßig im Wettbewerbs- und Heilmittelwerberecht. |