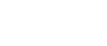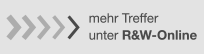Diarra und die drohende Milliardenklage

Jörg von Appen
Denkbar sind Kartellschadensersatzansprüche der geschädigten Spieler gegen die FIFA, aber auch gegen nationale Verbände, die die entsprechenden Statuten in ihren Regelwerken umgesetzt haben.
Das Diarra-Urteil des EuGH vom 4. 10. 2024 (EuGH, Urt. v. 4. 10. 2024 – C-650/22, ECLI:EU:C:2024:824) könnte sich, wenn man in einigen Jahren darauf zurückblickt, in seiner Bedeutung als dem berühmten Bosman-Urteil (EuGH, Urt. v. 15. 12. 1995, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463) mindestens ebenbürtig erweisen.
Was war passiert? Der Fußballspieler Diarra kündigte seinen 2013 mit Lokomotive Moskau abgeschlossenen Arbeitsvertrag einseitig und wollte danach zum belgischen Klub Charleroi wechseln. Dieser Wechsel kam jedoch nicht zustande, da Charleroi aufgrund des seit 2002 geltenden FIFA-Transferreglements (FIFA-RSTP) Sanktionen durch die FIFA befürchtete. Das FIFA-RSTP begründete eine Mithaftung des neuen Klubs für die Entschädigung des früheren Klubs im Falle des Vertragsbruches des Spielers. Bei einer Anstiftung des Spielers zum Vertragsbruch drohte dem neuen Klub – neben der Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von über 10 Millionen Euro – gar eine einjährige Transfersperre (wie im Fall des 1. FC Köln). Eine solche wird nach dem FIFA-RSTP sogar vermutet. Hiergegen klagte Diarra.
Der EuGH entschied, dass Teile des FIFA-RSTP sowohl gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus Art. 45 AEUV als auch gegen das Kartellverbot aus Art. 101 AEUV verstoßen.
Letzteres dürfte in seiner praktischen Konsequenz gravierender sein. Denn die Annahme eines Kartellverstoßes bereitet den von den kartellrechtswidrigen Statuten des FIFA-RSTP betroffenen Spielern den Boden für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, denen der EuGH bekanntlich eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der Wettbewerbsregeln beimisst und die daher konsequenterweise durch die Richtlinie 2014/104/EU (Kartellschadensersatzrichtlinie) mindestharmonisiert sind. Inzwischen schickt sich eine niederländische Stiftung namens Justice for Players (JfP) im Namen der Spieler im Wege einer Sammelklage an, solche kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche geltend zu machen. JfP hat angekündigt, im ersten Quartal 2026 Klage beim Bezirksgericht Midden-Nederland einzureichen. Nach “vorläufiger Einschätzung” einer Unternehmensberatung hätten europäische Profifußballer durch die beanstandeten Regelungen Einkommensverluste von ungefähr 8 % erlitten. Auch Diarra selbst hat nach Auskunft seiner Anwälte mittlerweile Klage gegen die FIFA und den Belgischen Fußballverband eingereicht und verlangt eine Entschädigung von 65 Millionen Euro.
Der Reihe nach: Der EuGH kam im Diarra-Urteil zu dem Schluss, dass die Regelungen in Art. 9 und 17 FIFA-RSTP bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen darstellen. Als wäre damit nicht schon für sich nur ein vergleichsweise kleiner Spalt für eine Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV eröffnet, hielt der EuGH in aller Deutlichkeit fest, dass die umfassende, dauerhafte und drastische Einschränkung des grenzüberschreitenden Wettbewerbs um die Arbeitskräfte aufgrund der Monopolstellung der FIFA, welche über die Bindung an das Regelwerk die komplette Arbeitgeberseite umfasse, als unvereinbar mit Art. 101 AEUV anzusehen sei. Zwar würde es sich nicht um eine klassische “No-Poach”-Vereinbarung handeln; die FIFA-RSTP-Regeln stünden diesen in ihrer Wirkung aber gleich. Rumms!
Eine Folge hieraus ist, dass Kartellschadensersatzansprüche der geschädigten Spieler gegen die FIFA, aber auch gegen nationale Verbände, die die entsprechenden Statuten in ihren Regelwerken umgesetzt haben, denkbar sind. Im deutschen Recht sind diese Ansprüche in § 33a GWB geregelt. Hier stellen sich ggf. spannende Anschlussfragen im Hinblick auf ein Verschulden der FIFA, den Nachweis eines kausalen Schadens, dessen Berechnung und eine eventuelle Verjährung. Für das deutsche Recht sind diese Fragen bislang (noch) allenfalls von theoretischem Interesse. Der Blick geht daher einstweilen gespannt in die Niederlande.
Demnächst wird die Rechtssache CD Tondela (EuGH, C-133/24, ECLI:EU:C/2024/3891) dem EuGH die Gelegenheit geben, sich erneut mit derartigen “No-Poach”-Vereinbarungen zu befassen. Als Lösung dieser Problematik könnten Tarifverträge zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen dienen. Derartige Verträge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sind schon aufgrund ihres Gegenstands gegen das unionsrechtliche Kartellverbot immun. Bis dahin droht der FIFA und den nationalen Verbänden (übrigens auch dem DFB) allerdings weiterhin Ungemach – Schadensersatzklagen wie von Diarra und der JfP könnten nur der Anfang sein.
RA Jörg von Appen, Hamburg