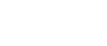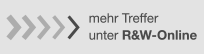Vor Hitze schützen: Auch für das UWG wichtig!

RAin Ulrike Gillner
Der Juni in diesem Jahr war heiß – zu heiß, wie Meteorologen konstatieren. Heiß her ging es parallel auch kurz vor der terminierten letzten Trilog-Verhandlung zur geplanten sog. Green Claims Richtlinie (RL COM(2023) 166 final). Während dieses EU-Regelungsvorhaben nach einem Kommunikationschaos aber nun erst einmal mindestens „auf Eis liegt“, geht es für die bereits in Kraft getretene EU-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (RL 2024/825/EU, EmpCo-RL) auf nationaler Ebene weiter:
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat kurz vor der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli 2025, nachdem der Diskussionsentwurf vom 09.12.2024 bereits einen Vorgeschmack gegeben hatte, den lang erwarteten Referentenentwurf „Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb“ (RefE) zur Umsetzung u. a. der EmpCo-RL vorgelegt. Diese soll Verbraucher darin stärken, nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen. Sie ändert die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (RL 2005/29/EG, UGP-RL). In Deutschland sind die Vorschriften der UGP-RL im UWG umgesetzt. Erwartungsgemäß soll es nun eine Änderung des UWG in einer 1:1-Umsetzung der EmpCo-RL geben.
Im Fokus des RefE steht eine Konkretisierung des allgemeinen Irreführungsverbots. Über deren Notwendigkeit braucht nicht mehr befunden zu werden. Der EU-Gesetzgeber hat dies, ungeachtet der Leitlinien der Kommission zur UGP-RL aus 2021, so gefordert und die EmpCo-RL zur weiteren Zubereitung bis zum 27.03.2026 auf nationaler Ebene serviert.
Zu den ausgewählten Zutaten gehören u. a. insgesamt 13 neue per se-Verbote im Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG-E. Davon betreffen die Nr. 2a sowie 4a–c Werbung mit Nachhaltigkeitssiegeln und Umweltaussagen.
So soll künftig eine „allgemeine Umweltaussage“ per se unzulässig sein, wenn der Unternehmer eine ihr zugrunde liegende „anerkannte hervorragende Umweltleistung“ nicht nachweisen kann (Nr. 4a Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG-E). In § 2 Abs. 2 Nr. 2 lit. b UWG-E findet sich zur Definition einer „anerkannten hervorragenden Umweltleistung“ ein Verweis auf DIN EN ISO 14024 Typ I. Diese DIN soll laut Fn. 2, S. 3 RefE extern „zu beziehen“ sein. Kostenpflichtig wohlgemerkt. Es verwundert kaum, dass eine Diskussion darüber entbrannt ist, ob dies so zulässig ist – vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH, wonach harmonisierte technische Normen frei und kostenlos zugänglich sein müssen (EuGH, 05.03.2024 – C-588/21 P, NJW 2024, 1325). Ob der weitere Hinweis in Fn. 2 RefE auf die archivmäßige Sicherung der Umweltkennzeichenregelungen in der Deutschen Nationalbibliothek hilft, mag bezweifelt werden.
Umweltaussagen in der Werbung für Produkte sind künftig per se unzulässig, wenn sie auf der Kompensation von Treibhausgasen beruhen (Nr. 4c Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG-E). Ob es dieses per se-Verbot gebraucht hätte? Spätestens die Grundsatzentscheidung zur Werbung mit „klimaneutral“ (BGH, 27.06.2024 – I ZR 98/23, WRP 2024, 928 – klimaneutral) hat die strengen Grenzen für Werbung mit Green Claims deutlich gemacht. Eine produktbezogene Werbung mit Umweltaussagen, die auf tatsächlichen Emissionseinsparungen in der Wertschöpfungskette über den gesamten Produktlebenszyklus beruhen, dürfte im Grunde weiterhin möglich sein. Auch sollte es zulässig sein, zu Investitionen in Kompensationsmaßnahmen ohne Produktbezug zu kommunizieren (vgl. Erwägungsgrund 12 EmpCo-RL).
Handfeste Auswirkungen auf die Praxis könnte der neue Blacklist-Tatbestand Nr. 2a Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG-E zur Werbung mit Nachhaltigkeitssiegeln haben: Danach ist das Anbringen eines Nachhaltigkeitssiegels per se unzulässig, wenn es „weder auf einem Zertifizierungssystem beruht noch von staatlichen Stellen festgesetzt wurde“. Bereits aktuell gelten strenge Anforderungen an Werbung mit Siegeln (vgl. BGH, 04.07.2019 – I ZR 161/18, WRP 2020, 317 – IVD-Gütesiegel), sodass es eines solchen Verbots kaum bedurft hätte. Zudem wird kritisiert, dass schon die diesbezügliche Regelung der EmpCo-RL markenrechtliche Implikationen nicht berücksichtigt. Nun geht der Gesetzgeber wohl davon aus, dass sich die Anzahl der Nachhaltigkeitslabel mittelfristig reduziert (S. 24 RefE).
Unbestimmte Rechtsbegriffe würzen außerdem die Vorgaben zur Werbung mit künftigen Umweltleistungen (§ 5 Abs. 3 Nr. 4 UWG-E), wie etwa „klimaneutral bis 2035“. Mit einhergehender Rechtsunsicherheit: Derartige Aussagen gegenüber Verbrauchern sollen irreführend sein, wenn kein „detaillierter und realistischer Umsetzungsplan“ zugrunde liegt, der „messbare und zeitgebundene Ziele“ enthält sowie „öffentlich einsehbar und überprüfbar“ ist und „regelmäßig von einem unabhängigen externen Sachverständigen überprüft wird“.
Viel Umsetzungsspielraum bleibt dem deutschen Gesetzgeber allerdings nicht. Die Emp-Co-RL wirkt vollharmonisierend, die Auslegung obliegt den Gerichten. Aufgeheizte Debatten im Gesetzgebungsverfahren sind kaum angebracht. Etwas Abkühlung täte jedenfalls gut, bis die neuen Vorschriften ab dem 27.09.2026 verzehrbereit anzuwenden sind.
RAin Ulrike Gillner, Bad Homburg