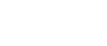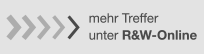Law Made in Germany

Mit dem Schlagwort Law Made in Germany weist das Bundesministerium der Justiz auf die weltweite Karriere des deutschen Rechts hin (vgl. dazu Pfeil, RIW 2009, Heft 5, Die erste Seite). Der deutsche Rechtskreis hat sich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, oft in Kombination mit dem der Schweiz oder Frankreichs, stetig erweitert. Der erste Schub geschah vor dem Ersten Weltkrieg, als deutsches Recht, ohne Mitwirkung der Reichsregierung, in Ostasien (China, Japan, Korea) übernommen wurde. Später gewann unser Recht Einfluss in Griechenland und der Türkei, von wo aus es, gemischt mit anderen Einflüssen, weitergegeben wurde, etwa nach Afghanistan. Bei den vom Kolonialismus befreiten jungen Staaten, etwa Südafrika, stand der Wunsch Pate, sich auch in der Rechtskultur vom ehemaligen Kolonialherrn zu lösen. Das ist etwa der Grund, weswegen sich im algerischen Code Civil deutliche deutsche Spuren zeigen (Aden, RIW 2009, Heft 9, Die erste Seite). In einem dritten Schub nach 1990 wurde deutsches Recht im Bereich der ehemaligen UdSSR fast flächendeckend übernommen.
Anders als beim französischen Code Civil und dem angelsächsischen “Gemeinen Recht” (common law) geschah die Ausbreitung deutschen Rechts ohne imperialistischen Druck. Es wurde freiwillig übernommen. Das führte zu wichtigen Unterschieden in der Art der Rechtsübernahme. Bei der kolonialen Ausbreitung des herrschenden Rechts wurde wenig Rücksicht auf die Gegebenheiten des aufnehmenden Volkes genommen. Bei der sozusagen “deutschen” Methode, bei der ein Staat sich selbst für eine Rechtsordnung entschied, wurde das importierte (deutsche) Recht von vornherein an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Deutsches Recht wurde daher meist nicht als bloße Kopie von Gesetzen aufgenommen, sondern in Form deutschen Rechtsdenkens. Das bürgerliche Recht, gleichsam die Anatomie des Rechts, prägt den Bau einer Rechtsordnung. Es war daher in erster Linie das BGB mit seiner Systematik und Begrifflichkeit, das Nachfolger fand.
Heute leben ca. 2 Mrd. Menschen zwischen Rhein und Pazifik in deutsch geprägten Rechtssystemen. Der “deutsche” Rechtskreis dürfte, gemessen an der Zahl seiner Rechtsgenossen, daher heute der weltweit größte sein – größer als der französische Rechtskreis und auch größer als der angelsächsische.
Der deutschen Öffentlichkeit ist das kaum bekannt. Auch die wenigsten deutschen Juristen wissen das. Die weite Verbreitung des deutschen Rechts bzw. seines systematischen Denkens gibt unserem Land politisches Ansehen und bietet für uns enorme wirtschaftliche Möglichkeiten. Diese bleiben jedoch leider oft ungenutzt. Anders gesagt: Wenn deutsche Unternehmen ihre internationalen, zunehmend auch nationalen Verträge unter ein angelsächsisches (englisches oder ein amerikanisches) Recht stellen, setzen sie sich Fehlerquellen aus, die bei Vereinbarung eines Systemrechts, also des deutschen oder eines deutsch geprägten Rechts, vermieden würden. Die langen amerikanischen Verträge voller Redundanzen und augenscheinlich künstlicher Probleme wären vermeidbar. Nach einer überschlagsmäßigen Schätzung des Verfassers beträgt der Redundanzfaktor von Systemrecht zu angelsächsischem Recht etwa 50 %; d. h., wo ein Systemrecht für einen Rechtstext 100 Wörter braucht, benötigt das common law 150. Für Herstellung und “Endabnahme” von 50 zusätzlichen Wörtern Rechtstext braucht ein Anwalt überschlägig 15 Minuten. Bei einem Anwaltsstundensatz von kaum unter $ 500 sind das $ 125/50 Wörter. Hausjuristen deutscher Unternehmen mögen einmal durchrechnen, was es nur unter diesem Gesichtspunkt kostet, New Yorker Recht anstelle des deutschen oder chinesischen Rechts zu vereinbaren.
Es muss nicht betont werden, dass die Vereinbarung von New Yorker oder englischem Recht und eines Gerichtsstands dort sinnvoll sein kann. Wir Deutschen sind aber nicht davor gefeit, uns von angelsächsischen Anwälten etwas vormachen zu lassen. An solchen Konstruktionen verdienen in erster Linie diese. Es wirkt sich immer stärker aus, dass praktisch alle in Deutschland tätigen wirtschaftsrechtlichen Großkanzleien in amerikanischen oder englischen Händen sind. Diese sind bei ihren Empfehlungen nicht immer frei von Honorarüberlegungen. Deutsche Unternehmensjuristen, an sich selbst und unserem Recht zweifelnd, vertrauen sich dann lieber den slings and arrows des angelsächsischen Rechts an, um mit dem ewigen Selbstzweifler Hamlet zu sprechen. Es sind wohl auch Minderwertigkeitskomplexe, wenn deutsche Juristen das angelsächsische Recht so hoch ins Licht stellen, dass die darin lauernden Kostenfallen im Schatten bleiben. Dies ist kein Boykottaufruf. Aber deutsche Unternehmen sollten prüfen, ob sie in dieser Hinsicht wirklich immer gut beraten sind.
Es ist hier nicht der Ort, Vor- und Nachteile des deutschen Systemrechts gegenüber anderen Rechtsordnungen zu behandeln. Wie Sprachen ihre typischen Besonderheien haben, welche je nach Fall nützlich oder hinderlich sein können, so auch Rechtsordnungen. Es soll hier aber für mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf die Verwendung des deutschen Rechts geworben werden.
Professor Dr. Menno Aden, Essen