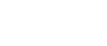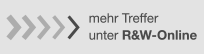Die “State Aid Modernisation Initiative” der EU-Kommission

Während seine Vorgängerin Neelie Kroes gleich zu Beginn ihrer Amtszeit ihr Hauptreformprojekt verkündet hatte, den sog. “Aktionsplan Staatliche Beihilfen” (englische Bezeichung: “State Aid Action Plan” oder kurz “SAAP”), war von dem derzeitigen Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia lange Zeit nichts zur Beihilfenpolitik zu vernehmen. Die Maschinerie der Generaldirektion Wettbewerb lief nach seinem Antritt im Februar 2010 einfach weiter, die Dossiers wurden brav bearbeitet, manche auch entschieden. Weder die breite Öffentlichkeit noch die Fachkreise wussten aber, wohin der neue Chef der Brüsseler Wettbewerbskontrolle eigentlich wollte, für was er denn nun stand, was er in seinen fünf Jahren zu bewegen dachte. Zwei Jahre nach dem Amtsantritt wird dies nun klarer. Bereits am 2. 2. 2012 fand im Charlemagne-Gebäude in Brüssel eine große, der Öffentlichkeit zugängliche Wettbewerbskonferenz statt, in der Ideen zu den drei großen Themen Kartelle, Fusionskontrolle und staatliche Beihilfen vorgetragen wurden. Für den 6. 3. 2012 lud dann der Generaldirektor der DG COMP zu einem runden Tisch mit den Mitgliedstaaten speziell für den Bereich der Beihilfenkontrolle ein. Nicht nur wird aus dieser Einladung deutlich, welche Bereiche in den verbleibenden drei Jahren, die der jetzigen Kommission noch bleiben, reformiert werden sollen; gleichzeitig offenbart dieses neue, neben die bekannten sog. Multilateralen Sitzungen zwischen Kommission und Mitgliedstaaten (die stets auf Arbeitsebene stattfinden) tretende Format, in dem der Generaldirektor seine “Peers” aus den nationalen Verwaltungen an den Tisch bittet, dass die Diskussion darüber, wie die künftigen Regeln für die Beihilfenkontrolle aussehen sollen, mit den Spitzen der mitgliedstaatlichen Administrationen und nicht länger mit der operationellen Ebene geführt werden soll.
Diese Entwicklung ist nicht nur begrüßenswert, sondern auch längst überfällig. Kein Bereich des Unionsrechts wird so sorgsam als Monopol der Verwaltungen gehütet wie die EU-Beihilfenkontrolle, wo Kommissionsbeamte lediglich mit den Beamten in den Mitgliedstaaten reden und die betroffenen Unternehmen vor der Tür warten müssen, bis drinnen entschieden ist. Traditionalistisch veranlagte Kommissionsbeamte sind gar der absurden Auffassung, dass sie eine “Dienstleistung gegenüber den Mitgliedstaaten” erbringen – eine sonderbare Geisteshaltung, vergegenwärtigt man sich, das die EU-Beihilfenkontrolle das Ausgabeverhalten der Mitgliedstaaten auf seine Wettbewerbskonformität hin überprüfen soll.
Dass eine effiziente Beihilfenkontrolle nur dann zustande kommt, wenn Dritte wie Begünstigte und Beschwerdeführer eine aktive Rolle im Prüfverfahren spielen dürfen, das hat man in der Generaldirektion Wettbewerb erkannt. Klar zielen die in dem, was nunmehr unter dem Stichwort der “State Aid Modernisation Initiative” läuft, angesprochenen Punkte auf die Erzielung eines auf höherer politischer Ebene auszuhandelnden Kompromisses. Die Kommission nennt hier folgende Hauptbestandteile dessen, was sie als einen “umfassenden Ansatz” bezeichnet, im Einzelnen praktisch handhabbare Erläuterungen zum Begriff der staatlichen Beihilfe und hier vor allem zu den Tatbestandsmerkmalen der Begünstigung und der Selektivität, eine Reform der De-Minimis-Regeln, eine (deutliche) Ausweitung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, eine Konsolidierung und Vereinfachung der derzeitigen Genehmigungsregeln und, nota bene, eine Reform der Verfahrensregeln.
Für die Mitgliedstaaten ist also viel im Geschenkkorb. Sie können sich bei “De-Minimis” verbessern, über die erweiterte Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung neue Förderfreiheiten erwerben und leichter verständliche Genehmigungsregeln erringen. Hierfür wird es indes einen Preis geben, der in der Effektivierung der Beihilfenkontrolle qua Verfahrensreform liegen wird. Diese kann zuvörderst durch eine volle Beteiligung der sog. Dritten zustande kommen. Bisher waren die auf Arbeitsebene agierenden nationalen Beamten, die dann auch die Stimme ihres Mitgliedstaates bildeten, hierzu nicht oder kaum bereit. Zu stark würde andernfalls ihr Einfluss begrenzt werden, der sich in der geschilderten Monopolstellung bisher ungehindert entfalten konnte. Die verschiedenen Versuche der Luxemburger Unionsgerichte, gerade des Gerichts der EU (vormals Gericht erster Instanz), diese Situation grundlegend zu ändern, schlugen nicht zuletzt deshalb fehl, weil der EuGH das Rad der Zeit immer wieder zurückdrehte (auch wenn er in der jüngsten Vergangenheit mit verschiedenen Urteilen sehr zum Wohle der Beschwerdeführer gewirkt hat) und eine Veränderung der Verfahrensregeln zur Voraussetzung erklärte.
Der Initiative der Kommission, die Diskussion um die Reform der EU-Beihilfenkontrolle auf der Ebene der Mitgliedstaaten zur Chefsache zu machen und auf diese Weise neue Flexibilität zu erreichen, ist bester Erfolg zu wünschen. Wo sie derzeit steht, werden Vizepräsident Almunia und die Spitzen der Generaldirektion u. a. auf der – vom Autor dieser Zeilen ins Leben gerufenen – Jahrestagung des “European State Aid Law Institute” im Juni 2012 der Öffentlichkeit mitteilen. Das Programm dieser Tagung kann abgerufen werden unter: http://ec.europa.eu/competition/state aid/what is new/estali spring2012en.pdf.
Dr. Andreas Bartosch, Rechtsanwalt, Brüssel