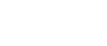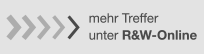Willkommen zur 18. Ausgabe ãGeldwûÊsche & Rechtã

Dr. Jacob Wende

Penelope Schneider

Prof. Dr. Kilian Wagner
Liebe Leserinnen und Leser,
der europûÊische Gesetzgeber hat mit der neuen EU-GeldwûÊscheverordnung (EU-AML-VO) einerseits zwar zahlreiche bû¥rokratische Irrwege ohne erkennbaren Gewinn fû¥r die BekûÊmpfung der FinanzkriminalitûÊt eingeschlagen, andererseits aber auch einige mutige Weichenstellungen vorgenommen. Eine der vielleicht folgenreichsten Neuerungen ist Art.ã75 EU-AML-VO. Diese Norm schafft erstmals eine explizite Rechtsgrundlage fû¥r den Datenaustausch zwischen Verpflichteten ã einschlieûlich der MûÑglichkeit ûÑffentlich-privater Partnerschaften. Was in Pilotprojekten wie dem niederlûÊndischen TMNL oder dem deutschen EuroDaT-Projekt bereits angedacht wurde, kûÑnnte nun EU-weit Schule machen.
Der Weg von der Norm zu funktionierenden Austauschsystemen ist allerdings weit. Fragen des Datenschutzes und der operationellen Umsetzung sind noch lûÊngst nicht abschlieûend geklûÊrt. Gleichzeitig wûÊchst der Druck auf die Praxis, den regulatorischen Gestaltungsspielraum auch zu nutzen: Die AMLA nimmt ihre Arbeit auf, die FATF-Prû¥fzyklen werden dichter ã und die Bedrohung durch komplexe FinanzkriminalitûÊt bleibt hoch. Das vorliegende Heft widmet sich diesen Herausforderungen daher mit einem thematischen Schwerpunkt auf den neuen MûÑglichkeiten und offenen Fragen rund um Art.ã75 EU-AML-VO:
Den Auftakt macht Johanna Mayrhofer, die das schon erwûÊhnte Projekt safeAML der EuroDaT-GmbH kurz vorstellt. Die Projektverantwortlichen haben uns eine genauere Einfû¥hrung fû¥r eines der Folgehefte bereits zugesagt.
Benjamin Vogel nimmt daraufhin die MûÑglichkeiten und Risiken ûÑffentlich-privater Partnerschaften im Bereich des Informationsaustausches in den Blick. Seine Analyse betont das Potenzial behûÑrdlicher Beteiligung am Datenaustausch ã etwa durch die FIU ã und macht zugleich deutlich, wie sensibel der rechtliche Rahmen fû¥r operative Datenweitergabe bleiben muss.
Unser Co-Schriftleiter Kilian Wegner legt in seinem Beitrag das Augenmerk auf das Potenzial, das aus Art.ã75 EU-AML-VO fû¥r das kollaborative Transaktionsmonitoring folgt. Neben einem Vorschlag fû¥r ein risikoadaptiertes ãLeitermodellã setzt er sich dabei eingehend mit rechtlichen InterpretationsmûÑglichkeiten der Vorschrift auseinander.
Etwas abseits des Schwerpunkts, aber nicht minder praxisrelevant, untersucht Niclas-Andreas Mû¥ller die aktualisierten Regelungen zum Umgang mit Hochrisiko-DrittlûÊndern. Ein Thema, das durch die jû¥ngsten ûnderungen der EU-LûÊnderliste und die Reaktion des EuropûÊischen Parlaments auf den Vorschlag der Kommission, die Vereinigten Arabischen Emirate von der Liste der Hochrisiko-Staaten zu streichen, an Brisanz gewonnen hat.
Eine wertvolle Auûenperspektive auf das Thema GeldwûÊschebekûÊmpfung bietet das Interview mit den hr-Journalisten Jens Borchers und Oliver Gû¥nther, die mit ihrem Podcast ãGeldwûÊsche-Paradies Deutschlandã eine breitere ûffentlichkeit fû¥r das Thema sensibilisieren konnten. Ihr Einblick in Rechercheprozesse und ûÑffentliche Wahrnehmung ergûÊnzt die juristische Debatte um eine gesellschaftspolitische Dimension.
Wie gewohnt schlieût das Heft mit der Literaturû¥bersicht von Philipp Rhein, der die wichtigsten VerûÑffentlichungen zum GeldwûÊscherecht des zweiten Quartals 2025 zusammenfasst ã sowie einer Rezension von Marcus Bauckmann, der die vierte Auflage des Zentes/Glaab-Kommentars vorstellt.
Wir wû¥nschen eine erkenntnisreiche Lektû¥re!
Ihre Redaktion
Dr. Jacob Wende, Penelope Schneider, Prof. Dr. Kilian Wegner