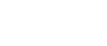Das PSPP-Urteil des EuGH als Provokation der Eskalation

Mit Urteil vom 11. 12. 2018 (C-493/17, Weiss) hat der EuGH das billionenschwere Public Sector Purchase Programme (PSPP) der EZB als unionsrechtskonform qualifiziert. Das PSPP wurde am 4. 3. 2015 von der EZB als zentrales Unterprogramm des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) aufgelegt, um die geldpolitische Transmission zu gewährleisten und mittelfristig Inflationsraten von unter, aber nahe 2 % zu erreichen. Rund 90 % der Ankäufe erfolgten durch die nationalen Zentralbanken. Diese erwarben in erster Linie notenbankfähige Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen Emittenten des eigenen Hoheitsgebiets an den Sekundärmärkten. Die Verteilung erfolgte grundsätzlich entsprechend den jeweiligen Anteilen am Kapitalschlüssel der EZB. Etwaige Verluste sind insoweit von der jeweiligen Notenbank selbst zu tragen. Einer Risikoteilung unterliegen dagegen die etwa 10 % des gesamten Portfolios ausmachenden und von einzelnen Zentralbanken zusätzlich erworbenen Wertpapiere internationaler und supranationaler Emittenten. Das monatliche Ankaufvolumen des EAPP betrug bis zu 80 Mrd. Euro im Monat und summierte sich für das PSPP auf eine Gesamtsumme von rund 2,1 Billionen Euro. Zwar hat der EZB-Rat zwischenzeitlich die Einstellung neuer Anleihekäufe im Rahmen des EAPP zum Jahresende 2018 beschlossen. Die Tilgungsbeträge der erworbenen Wertpapiere sollen vom Eurosystem bei Fälligkeit aber weiter vollumfänglich reinvestiert werden.
Gegen die Mitwirkung von Bundesbank, Bundesregierung und Bundestag an dem Anleihekaufprogramm wurden Verfassungsbeschwerden erhoben. Das BVerfG machte sich die Bedenken (zumindest partiell) zu eigen und unterbreitete dem EuGH am 18. 7. 2017 mehrere Vorlagefragen. Dabei führte der Zweite Senat zum einen Gründe an, wonach die einschlägigen Beschlüsse mit dem Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung (Art. 123 Abs. 1 AEUV) kollidieren und das währungspolitische Mandat der EZB überschreiten. Zum anderen wurde der EuGH um Klärung ersucht, ob eine möglicherweise im Programm angelegte unbegrenzte Risikoteilung innerhalb des Eurosystems gegen die Identitätsgarantie des Art. 4 Abs. 2 EUV sowie die Art. 123 und 125 AEUV verstößt.
In seinem Urteil gelangt der Gerichtshof übereinstimmend mit Generalanwalt Wathelet und unter vielfältiger Bezugnahme auf seine Gauweiler-Entscheidung (C-62/14) zur Vereinbarkeit des PSPP mit dem EU-Recht. Einer Überschreitung des geldpolitischen Mandats der EZB werden das Fehlen offensichtlicher Beurteilungsmängel sowie die Erkenntnis entgegengehalten, dass sich der Charakter einer währungspolitischen Maßnahme nicht durch mittelbare wirtschaftspolitische Auswirkungen wandele. Der Vorwurf eines Verstoßes gegen das Verbot der monetären Finanzierung laufe ins Leere, weil die Durchführung des Programms nicht wirkungsgleich mit dem Ankauf von Anleihen an den Primärmärkten sei und den Mitgliedstaaten nicht den Anreiz zur Verfolgung einer gesunden Haushaltspolitik nehme. Die Vorlagefrage nach einer im PSPP angelegten unbegrenzten Risikoteilung scheitere schließlich an ihrem hypothetischen Charakter und sei daher bereits unzulässig.
Erste Reaktionen auf das Urteil fielen überwiegend zustimmend aus. Der EuGH zeige “auf geradezu vorbildhafte Weise die rationalisierende Wirkung rechtlicher Diskurse” (Goldmann, VerfBlog v. 12. 12. 2018). Ihm sei durch die Kontrollbeschränkung auf offensichtliche Beurteilungsfehler ein “geschickter Kunstgriff” gelungen, aus dem voraussichtlich die Erfolglosigkeit der Verfassungsbeschwerden resultiere (Wieland, LTO v. 11. 12. 2018). Überraschend erscheint bei dieser Rezeption weniger die positive Würdigung der erwartbaren Ausführungen des EuGH zur Kompetenzgemäßheit des Handelns der EZB (im Vorfeld bereits Ludwigs, NJW 2017, 3563, 3565 f.) als vielmehr die gänzliche Ausblendung der Vorlagefrage zur denkbaren Modifizierung der Risikoteilung. Just hierin liegt eine erhebliche Sprengkraft, ja eine regelrechte Provokation der Eskalation. Der EuGH unterstellt dem Zweiten Senat nicht weniger als ein Verkennen basaler Anforderungen des EU-Prozessrechts. Dem wechselseitigen Kooperationsverhältnis wird dies kaum gerecht, zumal der Gerichtshof die Erforderlichkeit von Vorabentscheidungsersuchen traditionell nur zurückhaltend prüft. Einen aktuellen Beleg hierfür liefert das nur einen Tag zuvor, am 10. 12. 2018, ergangene Wightman-Urteil (C-621/18). Überraschen muss die Rigidität des EuGH zudem im Lichte der moderat formulierten Vorlage des BVerfG. Anders als im OMT-Verfahren liest sich diese nicht wie ein Diktat, sondern als sachorientierte Bitte nach justiziellem Dialog. Der EuGH verweigert das Gesprächsangebot für die Vorlagefrage zur Risikoteilung apodiktisch und setzt mit dem Hinweis auf ein andernfalls drohendes eigenes Handeln ultra vires (Rn. 166) sogar noch eine besondere Spitze. Im Übrigen ist zwar zuzugeben, dass die EZB bislang keine Maßnahme erlassen hat, die eine Teilung sämtlicher von den nationalen Zentralbanken im Rahmen des PSPP erwirtschafteter Verluste vorsieht. Dies erkennend wurde vom BVerfG aber mit Recht auf den plausiblen Vortrag der Beschwerdeführer verwiesen, wonach ein entsprechender Beschluss nach Art. 32.4 ESZB-/EZB-Satzung beim Ausfall von Anleihen einer Zentralregierung “naheliegend, wenn nicht sogar zwingend” sei.
Fragt man vor diesem Hintergrund nach den möglichen Reaktionen des Zweiten Senats, so erscheint es keineswegs unwahrscheinlich, dass dieser dem EuGH erstmalig die Gefolgschaft verweigern wird. Gleichwohl muss es nicht zwangsläufig zu einer Eskalation kommen. Stattdessen könnte sich das BVerfG darauf beschränken, im Hinblick auf die Auslegung der ESZB-/EZB-Satzung deutlich zu machen, dass eine volle Risikoteilung mit der in Art. 79 Abs. 3 GG verankerten haushaltpolitischen Gesamtverantwortung des Bundestages unvereinbar wäre und die deutschen Staatsorgane für ein solches Szenario zu (konkreten) Gegenmaßnahmen verpflichten. Nur wenn die EZB einen solchen Beschluss dennoch erlassen und der EuGH diesen billigen sollte, käme es zum Schwur. Bis dahin sollte dem BVerfG der geforderte Spagat zwischen Selbstbehauptung und Kooperation erneut gelingen.
Prof. Dr. Markus LudwigsJulius-Maximilians-Universität Würzburg