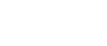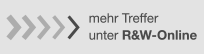Seite IX Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Grundlagen zu Daten
- A. Begriffsbestimmung
- B. Rechtliche Kategorisierung von Daten
- C. Ökonomische Einordnung von Daten
- Kapitel 3: Schutzmöglichkeiten von Daten
- A. Proprietärer Schutz von Daten
- B. Schutz von Daten durch das Urheberrecht
- C. Schutz von Daten durch das Geschäftsgeheimnisrecht
- D. Schutz von Daten durch das Deliktsrecht
- Kapitel 4: Vertraglicher Schutz von Daten
- Kapitel 5: Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Rechten an Daten
- A. Rechtfertigung staatlichen Eingriffs in den Datenmarkt
- B. Mögliche Ansätze zur Zuweisung von Rechten an Daten
- Kapitel 6: EU-Data Act als Lösung
- A. Zielsetzung
- B. Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich
- C. Rechte und Pflichten von Akteuren der Wertschöpfungskette
- I. Verhältnis zwischen Nutzer und Hersteller/Dateninhaber
- II. Verhältnis zwischen Nutzer und Dritten
- III. Verhältnis zwischen Dateninhabern und Datenempfängern
- D. Kritische Würdigung: Schwächen des Data Acts
- I. Keine ausreichende Stärkung der Position der Nutzer
- II. Anerkennung der technisch-faktischen Alleinkontrolle der Dateninhaber
- III. Marktauswirkungen: Keine volle Wertausschöpfung aus Daten
- IV. Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten
- V. Stellungnahme
- E. Ansätze zur Ausgestaltung des neuen Datengesetzes
- I. Verteilung von Rechten an Daten zugunsten Hersteller und Nutzer
- II. Stärkung von Nutzerrechten
- III. Beschränkung der technischen Alleinkontrolle der Dateninhaber
- IV. Mehr Wertschöpfung aus Daten
- V. Aufhebung des Verbots für Wettbewerbsprodukte
- VI. Aufhebung der Gegenleistungspflicht für Dritte
- VI. Abbau technischer Hindernisse
- Kapitel 7: Zusammenfassung/Ausblick
- Literaturverzeichnis